












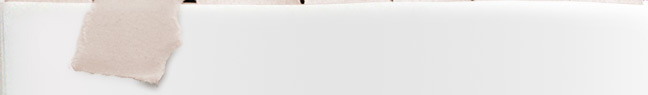





Die Blutlüge
„Ho, mes enfants, ho!“, rief der Kutscher auf dem Bock. Das Gefährt kam in einem letzten Ruck zum Stillstand.
Marion verschob den Vorhang vor dem Fenster.
„Wir sind da, Madame!“, meinte sie.
„Sehr schön“, nickte Isabelle ihrer Zofe zu. „Ruf Bernard, er soll den Korb tragen. Aber achte darauf, dass er keine Pastete einsteckt. Letztes Mal fehlten zwei Stück.“
Der Schlag wurde geöffnet und das Treppchen aufgestellt. Isabelle setzte ihre Halbmaske auf und streifte ihre Handschuhe über. Conrad de Branne verließ als erster den Wagen, wandte sich dann um, um ihr zu helfen. Isabelle zwängte ihre bauschigen Röcke durch die schmale Öffnung, ergriff die Hand ihres Sekretärs und entstieg dem Gefährt.
Sie sah sich kurz um. Die Kutsche hatte in der rue Saint-Paul gehalten. Das Haus, das Isabelle aufsuchen wollte, befand sich in einer dieser typischen Pariser Gassen, die für den prächtigen Vierspanner der Faurepas viel zu eng waren. Man war gezwungen, ein paar Schritte zu Fuß zu gehen und sich einen Weg durch die Menschen zu bahnen.
Isabelle war es gewohnt, dass ihre Ankunft und die ihrer Dienerschar den Schreiern und Händlern, Bettelmönchen und leichten Mädchen, Passanten und Gesindel, die sich wie ein bunter Strom durch die rue Saint-Paul schoben, Anlass bot, stehen zu bleiben. Sie störte sich nicht an den neugierigen Gesichtern. Während sie zielstrebig in die dunkle Seitengasse einbog, warf sie einen Blick nach oben. Die fünf Stockwerke der grauen, wettergegerbten Häuser machten es einem nicht leicht, ein Stück Himmel zu entdecken, doch sie erspähte die bleiche Wintersonne hinter dahinjagenden Wolken. Der Wind pfiff durch die Häuserschluchten, zerrte an ihrem Mantel und wirbelte ihr die blonden Locken in die Augen. Dennoch war die Luft schwer, fast greifbar, und der Straßenkot strömte heute einen erdigen, satten Geruch aus, der sich mit den feuchten Ausdünstungen der nahen Seine vermischte. Isabelle fröstelte. Wie stets spürte sie überdeutlich, wenn ein Wetterumschwung bevorstand.
Isabelle begegnete Marions fragendem Blick und lächelte.
„Es wird heute noch schneien“, meinte sie. „Wir werden uns beeilen.“
Isabelle beschleunigte ihre Schritte. Das Wetter würde ihr einen guten Vorwand bieten, bald wieder nach Hause zurückzukehren. Sie hielt ein Seufzen zurück. Sonst freute sie sich immer über ihren wöchentlichen Besuch bei den kleinen Arbeiterinnen von Saint-Paul, doch heute war es anders.
Sie hatte heute Nacht kaum Schlaf gefunden. Irgendetwas braute sich zuhause zusammen, das spürte sie genauso deutlich wie die Masse des Schnees, die über ihren Köpfen hing. Eine unsichtbare Spannung lag seit ein paar Tagen in den prunkvollen Räumen des Hôtel de Noirlieu, eine stille Erwartung. Es war nichts, was Isabelle hätte benennen können, doch sie wurde das Gefühl nicht los, dass es etwas mit ihr zu tun haben könnte, und es führte dazu, dass sie sich nicht gerne längere Zeit von zu Hause entfernte.
„Madame, schauen Sie!“, sagte Conrad de Branne und wies zur Seite, auf einen winzigen Laden, der Stiche anbot. „Ist das nicht überraschend?“
Das Geschäft war so schmal, dass es nur aus einer Tür und einer zwei Fuß breiten Auslage bestand. Sein Besitzer, dem es offenbar am Herzen lag, auf die Vielfalt seines Sortiments hinzuweisen, hatte sich nicht anders zu helfen gewusst, als zusätzlich zu seiner Auslage die Fassade des Hauses zu nutzen. Dazu hatte er einen Teil seiner bedruckten Blätter auf den massiven Holzladen genagelt, mit dem er Nachts sein Geschäft sicherte, und diesen anschließend auf das schmutzgraue Mauerwerk über seiner Tür gehängt. Dort flatterten die Stiche im böigen Wind, wie die frisch gewaschenen Servietten der Pariser Wäscherinnen auf der berge de la Grenouillère.
Isabelle verstand nicht sofort, was die Aufmerksamkeit ihres Sekretärs erregt hatte. Die meisten der Abbildungen stellten Heilige dar, wahrscheinlich als Tribut an die Besucher der nahen Kirche Saint-Paul. Doch dann sah sie es auch: Ein Portrait, angebracht zwischen einem kahlköpfigen Heiligen Simon, der sich müde auf eine Säge stützte, und einem axtschwingenden Sankt Thaddäus: Ein scharf geschnittenes Gesicht, ein Mund, voll und lebenshungrig, über dem ein feiner Schnurrbart hing, leicht hervorstehende Augen unter hohen, gewölbten Brauen. Isabelle näherte sich dem Bild.
„Sie interessieren sich für den Helden von Rocroy, Madame?“, fragte ein Männlein, das flink wie ein Wiesel aus der Höhle seines Geschäfts hervorgeschossen war. Er stellte sich neben Isabelle, legte den Kopf schief, breitete die Hände aus. „Ah, Monsieur le Prince de Condé! Was für ein Mann! Ein Feldherr ohnegleichen! Ein wahrer Prinz Frankreichs! Es ist eine wunderbare Radierung. Darf ich Madame aufmerksam machen auf die kühnen Striche, die den Konturen des Portraits eine unübertroffene Ähnlichkeit mit dem Original verleihen? Und hier ...“, der Mann spreizte die Finger in einer fast zärtlichen Bewegung, „... auf die zarten, gleichmäßigen Schraffuren, die diesem edlen Gesicht eine schreiende Lebendigkeit verleihen? Sie werden kaum ein ebenso gutes, geschweige denn ein besseres Portrait des Prinzen in der Stadt finden!“
„Da mögen Sie Recht haben, Monsieur“, antwortete Isabelle leichthin. „Portraits von Monsieur le Prince de Condé sind nur schwer zu finden in diesen Zeiten.“
„Zu Unrecht, wenn Madame mir erlauben, meine Meinung auszusprechen, sehr zu Unrecht! Ein Mann, der unser Land vor der spanischen Invasion rettete, zu einem Zeitpunkt, an dem bereits alles verloren schien! Ein Mann, der ...“
„... der seit fast einem Jahr im Gefängnis sitzt, Monsieur“, unterbrach Isabelle ihn kühl. „Auf Befehl Ihrer Majestät Anne, der Königin-Mutter.“
„Auf Befehl unseres sehr verehrten ersten Ministers, Monsieur le Cardinal de Mazarin, der befürchten musste, die erfolgreichen Feldzüge von Monsieur le Prince und dessen steigender Einfluss könnten ihn von dem bevorzugten Platz verdrängen, den er bei der Königin-Mutter innehat, Madame“, widersprach der Händler mit einer kleinen Verbeugung.
Isabelle senkte die Lider. Es war in diesen unruhigen Zeiten nicht klug, sich zu politischen Äußerungen hinreißen zu lassen. „Wie viel möchten Sie für das Portrait haben?“, fragte sie stattdessen.
Der Händler schmunzelte, deutete in Richtung von Isabelles Kutsche, auf dessen Schlägen weithin sichtbar das rotschwarze Wappen der Faurepas de Noirlieus prangte. „Geben Sie mir dafür, was immer Sie möchten, Madame. Ich weiß, dass das Haus Noirlieu eines der wenigen ist, die den wahren Wert von Monsieur le Prince kennen.“
Isabelle konnte ein Lächeln nicht mehr unterdrücken. Sie machte ihrer Zofe ein Zeichen. „Bezahl ihn, Marion. Und dann lass das Portrait nach Hause schicken, ich möchte es Monsieur meinem Großvater schenken.“ Ohne zu Warten setzte sie ihren Weg fort.
(…)
„Klopf an, Mathieu, und melde uns“, sagte Isabelle einem der beiden Lakaien. Mathieu betätigte den eisernen Türklopfer, und alsbald erschien ein rundliches Dienstmädchen.
Das Haus war in seinem Inneren genauso düster wie von außen, doch das lag an der Winzigkeit der Fenster, nicht an der Sauberkeit der Scheiben. Isabelle ignorierte das Summen der vielen Stimmen, das aus einem Raum zu ihrer Linken drang, und bog in den akkurat gefegten Flur ab. Ein paar Sekunden später stand sie einer älteren Frau mit hohlen Wangen und aufwändig besticktem Brusttuch gegenüber, die in einer tiefen Reverenz versank.
„Nun, Madame Muguet, wie geht es Ihren Schützlingen?“, fragte Isabelle freundlich, während sie ihre Maske abnahm. „Sind Sie mit ihnen zufrieden?“
„Sehr zufrieden, Madame la Comtesse“, antwortete die Frau, ohne sich ein Lächeln abringen zu können. „Jacqueline und Mabile haben uns vor drei Tagen verlassen. Sie sind als Lehrlinge bei Colin le Vert angestellt worden, so dass wir gestern zwei neue Mädchen aufnehmen konnten.“
„Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Am besten gehen wir gleich in den Werkraum. Ich bin heute in Eile und kann nicht lange bleiben.“
„Aber natürlich“, antwortete die Frau und neigte den Kopf. „Wie gütig von Ihnen, dass Sie uns trotzdem besuchen! Wenn ich Sie bitten dürfte, mir zu folgen ...“
Als Isabelle und ihre Gefolgschaft hinter Madame Muguet den Werkraum betraten, verstummten die Stimmen. Etwa vierzig Mädchen zwischen zehn und vierzehn Jahren waren hier versammelt. Der Pfarrer von Saint-Paul hatte sie aus den zugleich notdürftigsten und tugendsamsten Familien seiner Gemeinde ausgesucht. Die Mädchen erhielten Arbeit, wurden mit dem Säubern und Ausbessern von Spitze, Wandteppichen oder kostbaren Stickereien beschäftigt und im Zeichnen unterrichtet. Ihre Arbeitszeiten waren so lang wie das Tageslicht, und sie wurden schlecht bezahlt, doch so wurde ihnen das Schicksal erspart, irgendwann einmal von ihren verzweifelten Eltern für ein paar Louis verkauft zu werden.
Von allen wohltätigen Einrichtungen, die die Faurepas regelmäßig unterstützten, waren die kleinen Arbeiterinnen von Saint-Paul diejenigen, die Isabelle am meisten am Herzen lagen. Sie machte Zeichen, und Bernard und ihre zwei livrierten Lakaien begannen in dem großen Raum mit niedriger Decke die Pasteten, Früchte und kleine Leckereien zu verteilen, die Isabelle sich von ihrem Koch hatte einpacken lassen.
Das muntere Geplapper der Mädchen setzte sofort wieder ein. Ihre flinken Hände ließen Kamm, Nadel und Goldfaden fallen und versuchten den Dienern unter Schmeicheleien den Inhalt der Körbe zu entwenden. Bernard, dem Isabelle eingeschärft hatte, Gerechtigkeit walten zu lassen, wehrte sich gutmütig und mit dem zufrieden leuchtenden Gesicht des Mannes, der selten das Glück hat, im Mittelpunkt weiblicher Aufmerksamkeit zu stehen.
Madame Muguet runzelte die Stirn angesichts des heiteren Durcheinanders, doch Isabelle wusste, wie dieser Strenge beizukommen war. Auf einen Wink hin händigte Marion der Aufseherin einen Beutel aus.
„Grüßen Sie bitte Monsieur l’abbé von mir, Madame. Und vielleicht können Sie mit einem Teil dieses Geldes etwas Feuerholz besorgen. Es ist eisig hier, und wenn Ihre Arbeiterinnen erkranken und ihre Aufträge nicht mehr erfüllen können, werden Ihnen Ihre Kunden davonlaufen.“
„Aber natürlich, Madame la Comtesse. Ganz nach Ihrem Wunsch“, lächelte sie zum ersten Mal. „Möchten Sie die zwei neuen Mädchen kennenlernen?“
„Mais oui, unbedingt“, nickte Isabelle.
Madame Muguet führte sie an eine Mauer, wo ein vergilbter, aber kostbarer Wandteppich aufgehängt worden war. Drei Mädchen standen davor. Als sich die drei umdrehten, traf es Isabelle wie ein Schlag. Sie blieb abrupt stehen und sog scharf die Luft ein.
„Madame? Madame la Comtesse? Ist Ihnen nicht gut?“
„Doch... Es ist alles in Ordnung, Madame Muguet“, lächelte Isabelle angestrengt. Noch während tausend angstvolle, wilde Gedanken durch ihren Kopf schossen, gelang es ihr, ihre Züge wieder unter Kontrolle zu bringen. Sie fing sich schnell ... das tat sie stets.
„Dies sind Ameline und Marie-Caton. Sie werden von Francine unterrichtet. Sagt Madame la Comtesse d’Arzelles guten Tag, mes filles“, mahnte Madame Muguet die Mädchen. Zwei von ihnen machten tiefe, unbeholfene Knickse, doch die dritte, diejenige, deren Anblick Isabelle so tief ins Herz schnitt, starrte Isabelle nur mit vor Bewunderung glänzenden Augen an. Wie klein sie war! Sie wirkte jünger, viel jünger als zehn. Als Madame Muguet sie am dünnen Arm packte, um sie in die Knie zu zwingen, winkte Isabelle ab. „Bist du Ameline?“, fragte sie das Mädchen.
Die Kleine nickte nur. Sie hatte wirre, braune Locken, die rings um ihre Haube herausguckten und die ängstlichen großen Augen einer Feldmaus.
Jetzt, wo Isabelle Ameline besser sah, verstand sie ihre eigene Reaktion nicht mehr. Eine Ähnlichkeit, mehr nicht. Die Kleine war zu jung, ihre Nase zu spitz. Trotzdem überkam Isabelle der Drang, das Mädchen zu berühren. Sie streckte eine Hand aus, strich über Amelines bleiche Wange.
„Sind Sie traurig, Madame?“, fragte das Mädchen. Madame Muguet zuckte zusammen. Isabelle lächelte leicht.
„Nein, nur ein wenig nachdenklich“, log sie. „Du erinnerst mich an jemanden. Hast du Geschwister, Ameline?“
„Ja, drei. Doch die können noch nichts verdienen. Ich bin die Einzige, die meinen Eltern hilft“, antwortete das Mädchen und streckte die flache Brust raus.
„Ja, ich verstehe gut, dass dich das Stolz macht, Ameline“, meinte Isabelle leise. Sie schlug die Augen nieder und wandte sich von dem Mädchen ab. Trauer und eine tiefe, längst vergessen geglaubte Sehnsucht regten sich in ihr. Sie schloss die Fäuste. Es war Zeit, nach Hause zu fahren.
.................................................................. 
Es war dunkel in dem Raum, in dem der Lakai Philippe zu warten geheißen hatte. Doch es war eine nach Wachs duftende, wohlige Dunkelheit, hervorgerufen von erlesenen Hölzern und dickem Brokat.
Es dämmerte bereits.
Philippe hatte vergessen, wie kurz die Tage im Januar in diesen Breitengraden waren. Er strich über eine stoffbespannte Truhe, die über und über mit bunter Petitpoint-Stickerei verziert war. Die Motive, exotische Blumen und Vögel, leuchteten wie Erinnerungen.
Wo war er letztes Jahr um diese Zeit?
Sofort spürte er Wärme auf der Haut, und grelle Sonnenstrahlen versengten seine geschlossenen Lider.
Er riss die Augen auf, schöpfte tief Luft.
Wie göttlich doch dieses Dämmerlicht war!
Das Dämmerlicht der Freiheit. Und dennoch ...
Er rollte unwillkürlich die Schultern. Ja, sicher, die Wunden waren verheilt. Schon seit Monaten. Er konnte seine Glieder bewegen. Er konnte diesen Raum verlassen, diese Stadt, dieses Land, wann immer er es wollte. Doch war das alleine Freiheit? Konnte man sich frei nennen, bevor ein Versprechen erfüllt, ein Verrat bestraft, Versäumtes nachgeholt worden war?
Er hatte seinen Leinensack auf einen Nussbaumstuhl mit hoher Lehne abgelegt. Der Schlamm war getrocknet, in der halben Stunde, seit der er hier wartete. Seine Hand blieb auf dem derben Stoff liegen. Da drinnen lagen sie ... Er konnte ihre Unebenheiten spüren, trotz des Leders, in die er sie geschlagen hatte. Dann richtete er sich auf.
Nein. Noch war er nicht frei.
„Sind Sie der Herr, der mich zu sprechen wünscht?“
Philippe drehte sich mit einem Ruck herum, die Hand bereits am Gürtel, sofort den altbekannten Schmerz der Anspannung in der Kehle. Als er sah, wer sich ihm genähert hatte, atmete er auf. Er ließ seine Rechte wieder von seiner Hüfte gleiten und hoffte, dass der Mann seine Reaktion nicht bemerkt hatte. Er verbeugte sich knapp. „Oui, Monsieur. Philippe de Rochastre.“
Der Mann blickte auf, runzelte die Stirn. Er hatte ein langes Gesicht und einen schmalen, aber breiten Mund, um den der Hochmut tiefe Kerben geschlagen hatte. „Octave de Pleinpont. Enchanté“, antwortete er langsam. Seine schweren Augenlider schlugen träge. „Nun, was oder wer führt Sie zu mir?“
„Ihre Leidenschaft, Monsieur.“ Der Vicomte Octave de Pleinpont begnügte sich, eine Braue zu heben. Philippe fuhr fort: „In der Postkutsche, mit der ich heute anreiste, wurde Ihr Name als der eines der engagiertesten Sammler der Stadt gepriesen. Hat man mich richtig unterrichtet?“
„Hmm. Sehr schmeichelhaft. Nun, es kommt darauf an, was Sie zu bieten haben. Denn das ist es doch, weshalb Sie hier sind, nehme ich an?“ Der Vicomte machte eine wegwerfende Bewegung. „Antike Münzen und Gravuren interessieren mich nicht. Das ist von Menschenhand hergestellter Firlefanz. Den überlasse ich anderen.“ Er taxierte Philippe. „Sie sehen wie ein weit gereister Mann aus. Ich nehme an, dass diese Postkutsche nicht nur aus Lyon kam. Das lässt mich hoffen.“
Philippe antwortete nicht, knöpfte aber den Kragen seiner abgewetzten Jacke bis zu seiner Brust auf. Er holte das Ledertäschchen hervor, das um seinen Hals hing. Als er es seinem Gastgeber hinhielt, fühlte er, wie die Anspannung seine Finger versteifte. Es kostete ihn Überwindung, das Täschchen loszulassen. Was er hier aus der Hand gab, war sein kostbarster Besitz.
Octave de Pleinpont fingerte an dem Kordelzug, der die Tasche verschloss, und ließ deren Inhalt auf seine offene Handfläche rollen.
Er stieß einen erstickten Laut aus, machte einen kleinen Schritt zurück. „Das ist ...“ Er eilte zu einem der beiden Fenster und hielt die rundliche Form in das Licht. „Jean! Kerzen, und zwar schnell!“, rief er in den Raum. Als ein Diener mit einem Leuchter erschien, hatte Pleinpont an der gänseeigroßen Kugel bereits gerochen, hatte sie befühlt und versucht, durch sie hindurch zu blasen. Nach einer letzten, eingehenden Studie bei Kerzenschein, drehte er sich Philippe wieder zu.
„Ein echtes Exemplar, wie mir scheint.“
„Das ist es.“ Philippe hatte die Reaktionen seines Gastgebers sehr genau verfolgt.
„Aus dem Okzident?“
„Es ist ein echter orientalischer Bezoar, Monsieur. Er stammt von einer persischen Ziege.“
„Woher haben sie ihn?“
„Von einem Jungen in Algier.“
„Also kam die Postkutsche wirklich von weiter als Lyon“, lächelte Pleinpont dünn.
„Von sehr viel weiter, Monsieur.“
„Sie waren selber im Reich der Ungläubigen?“
„Ich habe nicht vor, Sie mit meiner Lebensgeschichte zu langweilen“, antwortete Philippe kurz angebunden. „Haben Sie Interesse an dem Stück?“
„Interesse?“ Pleinpont bleckte die Zähne. Sie waren lang und gelb. „Monsieur, genau so gut könnten Sie mich fragen, ob ich daran interessiert bin, zu leben! Aber ich werde es Ihnen nicht abkaufen.“
„Aber ...“
Octave de Pleinpont sah ihn prüfend an. Zum ersten Mal fiel etwas von seinem Hochmut ab. Seine schweren Lider hoben sich und deckten bemerkenswert grüne Augen auf.
„Hören Sie, Monsieur, Sie beehren mich mit diesem Angebot. Sie haben mir mit Ihrem Besuch bewiesen, dass Sie mir vertrauen. Ich werde Ihnen deshalb die Wahrheit beichten: Ich kann Ihnen dieses Stück nicht bezahlen.“ Er lächelte erneut sein dünnes Lächeln. „Es liegt schlicht und ergreifend außerhalb meiner Möglichkeiten.“ Langsam, fast andächtig drehte er den Bezoar zwischen seinen langen gepflegten Fingern. „Ich weiß nicht, ob Sie sich über den Wert dieses Objektes völlig im Klaren sind. Ich selber habe noch nie ein Bezoar dieser Güte in dieser Größe gesehen.“ Er suchte Philippes Blick. „Das Pulver von orientalischem Bezoar wird in den Apotheken zu zehn Mal sein Gewicht in Gold gehandelt. Und dieses ist ein Sammler-Stück. Zu schade, um es zu zerstören.“ Er ließ die Kugel geschickt in seiner Hand hüpfen. Sein Lächeln verbreitete sich. Dann legte er den Schatz sachte und sichtlich bedauernd in Philippes Hand zurück und sagte knapp: „Sie werden sich an höhere Stelle wenden müssen.“
Philippe atmete tief ein. Er betrachtete seinen Gastgeber prüfend. „Können Sie mir raten, wen ich in dieser Angelegenheit ansprechen kann?“
„Es gibt zwei Sammler in Paris, die Ihnen Ihr Kleinod werden abkaufen können. Der eine ist Monseigneur Gaston d’Orléans, der Onkel unseres jungen Königs. Der andere ist Seine Eminenz, Cardinal Jules Mazarin, unser erster Minister.“
Philippe runzelte die Stirn. Pleinpont fuhr fort: „Ich möchte nicht unhöflich sein, aber Sie erwähnten eben nur kurz Ihren Namen. Sie sagten Rochastre ... Sind Sie mit den Vigueil de Rochastre aus der Champagne verwandt?“
„Ja, in der Tat.“ Philippe hob den Kopf. Er hielt Pleinponts Blick fest, als er fragte: „Kennen Sie meine Familie, Monsieur?“
„Nicht direkt, nein.“ Der Vicomte schlug die Lider nieder. Er machte eine vage Geste. Seine Stimme klang verändert, als er sagte: „Nur vom Hörensagen ... Es ist schon viele Jahre her.“
Philippe fühlte, wie seine Muskeln sich anspannten. Er zwang sich zur Ruhe. Nun was? Ihm war klar gewesen, dass man ihn früher oder später auf seine Vergangenheit hin ansprechen würde. Warum also nicht gleich? Er würde sich an die Blicke gewöhnen müssen, an die Andeutungen, an das vieldeutige Schweigen. Er musste über alldem stehen, wenn er an sein Ziel gelangen wollte. Hatte er nicht gelernt, das, was ihn am empfindlichsten traf, zu ignorieren?
Er wollte sich gerade mit einer knappen Verbeugung entfernen, als Pleinpont erneut das Wort ergriff.
„Darf ich fragen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Monsieur, für wen Sie sich entschieden haben?“ Philippe sah ihn fragend an, und er erläuterte: „Werden Sie den Bezoar dem Herzog d’Orléans oder Seiner Eminenz vorstellen?“
Philippe zog die Stirn kraus. Auf einmal hatte er das Gefühl, eine Prüfung bestehen zu müssen.
„Für Gaston d’Orléans“, antwortete er fest und ohne weiter nachzudenken.
Es schien die richtige Antwort zu sein. Über Pleinponts Lippen huschte ein Lächeln, er nickte kaum merklich.
.................................................................. 
Isabelle spähte angestrengt nach allen Seiten. Es war ein Lärm aus Hunderten von Kehlen. Und plötzlich entdeckte sie es: Ein Menschenmeer, das auf sie zurollte. Sie erbebte und fühlte, wie ihr Begleiter einen Arm um sie legte. (…)
Der Pöbel näherte sich. Langsam wurden die Worte verständlich, die die Menge jeden zweiten Schritt skandierte: „Le Roi! Le Roi! Le Roi!“
(…) Philippe de Vigueil stellte sich hinter Isabelle, umschloss sie fest mit seinen Armen. Dann erreichte sie die menschliche Welle. Sie wurden geschoben, mitgerissen ... Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als mitzulaufen, wenn sie nicht zu Boden geworfen und zertrampelt werden wollten. Isabelles Herz hämmerte wild in ihrer Brust. Die allermeisten Menschen waren höher gewachsen als sie, und machten trotz des schlammigen Bodens große Schritte. Sie hatte Mühe, mitzukommen, hastete und keuchte. Doch immer, wenn sie ausrutschte, wurde sie von den Armen ihres Begleiters aufgefangen und mitgezogen. Isabelle drückte diese Arme an sich, klammerte sich an ihnen fest.
„Le Roi! Le Roi! Le Roi!“
Noch immer wusste Isabelle nicht, um was es hier ging, und was die Menschen um sie herum so aufgebracht haben konnte. Längst hatten sie die Seine hinter sich gelassen. Sie versuchte, sich zu orientieren. Die Straßen wurden breiter.
„Le Roi!“
Isabelle zuckte zusammen. Sie hob den Kopf und schrie: „Es geht zum Palais Royal!“ Der betroffene Ausdruck auf dem Gesicht des Comte zeigte ihr, dass er sie verstanden hatte. Das Palais Royal – der König. Was ging hier vor?
Sie überholten Trommler, die vor einer Taverne standen. Eine Frau in Morgenrock und Nachtmütze stand in ihrer Mitte. Die Tür der Taverne stand offen. Drei unrasierte Männer traten aus dem Gebäude, Bündel von Musketen in den Armen, die sie alsbald begannen, zu verteilen. Zwei weitere schleppten unter Ächzen eine dicke Eisenkette heraus.
„Die Bürgerwehr!“, rief Isabelle. „Die Bürgerwehr geht unter die Waffen! Das kann nur auf Befehl vom Herzog d’Orléans geschehen sein!“ Die kleine Trommler-Gruppe bog im Laufschritt in eine Nebengasse ein.
„Sie werden die Tore der Stadt verriegeln!“, rief der Comte.
„Le Roi! Le Roi!“
Die Gebäude, die die Straße säumten, wurden zusehends prächtiger. Das imposante Antlitz des Palais Royal tauchte nun zwischen den Häuserfluchten auf.
Sie mieden den Vorplatz mit dem Corps de Garde und bogen in die Seitengassen ein. Schnell waren die Absperrungen überwunden, die des Nachts den Park dem Publikum verschlossen. Der Pöbel ergoss sich über die geharkten Kiesflächen, stampfte seine Abdrücke in das makellose Grün des Rasens und quetschte sich zwischen den Stämmen der kugelförmig gestutzten Bäume hindurch.
Eine sehr hohe, mit steinernen Ornamenten verzierte Mauer schirmte den größten Innenhof des Palais Royal vom Park ab. Sie wurde von sieben riesenhaften Portalen aus feinstem Schmiedewerk durchbrochen. Durch sie bekam man Einblick auf die zweistöckigen Haupttrakte des Palastes, die den Innenhof auf drei Seiten einfassten.
Isabelle und ihr Begleiter befanden sich noch immer im vordersten Teil der Menge, die sich nun an den Portalen aufstaute. Die Rufe wurden lauter, als mehrere Dutzend Soldaten der Schweizer Garde im Hof erschienen.
„Le Roi! Le Roi!“
Das Gebrüll war ohrenbetäubend. Die vorderen Reihen rüttelten aggressiv an den Toren, die hinteren beschimpften die Uniformierten und schoben sich weiter vor. Einige Menschen schrien, weil sie an den schmiedeeisernen Gittern zerdrückt wurden, doch ihre Hilferufe gingen in dem allgemeinen Lärm unter.
Auch Isabelle war zwischen Philippe de Vigueil und einem der Tore eingekeilt. Ihr Begleiter stützte sich mit versteiften Armen an den ziselierten Gittern ab. Die Adern an seinen Schläfen traten hervor, während er sich gegen den Druck der Menge stemmte. Isabelle versuchte, ihn zu entlasten, indem sie die gleiche Stellung einnahm und ihren Rücken gegen seine Brust presste.
„Lassen Sie nur“, hörte sie den Comte hinter sich keuchen. „Drehen Sie sich mir lieber zu!“
Sie wandte sich um. Schweißtropfen perlten an Philippe de Vigueils Haaransatz. Sein Atem ging gepresst. Sie sah ängstlich in sein Gesicht.
„Ja, das ist gut. Schauen Sie mich an“, nickte er. „Schauen Sie mich nur an. Ihre Augen ... Ich muss Ihre Augen sehen.“
Sie schluckte hart, gehorchte wie gebannt. Sein brennender Blick fing sie ein. Er hatte Augen in einem klaren, feuerfarbenen Bernsteinton. Was sie in ihnen las, erschütterte sie bis in die Fußspitzen. Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder.
Er lächelte. „Ja. Ganz genau so.“
Mein Gott, was geschah mit ihr? Etwas in ihr zog sich zusammen, weitete sich im nächsten Atemzug aus, bis es über sie hinauswuchs. Es überspülte sie, riss sie mit sich fort, und sie ließ es geschehen, willenlos, ohne Worte. Ihr ganzer Körper schmerzte. Alles, was sie vermochte, war ihm zugewandt zu verharren, ihn anzusehen, dem Sog dieser Augen zu gehorchen. Sein Atem traf in kurzen Abständen ihre Stirn – sie hingegen bekam kaum noch Luft, und sie stöhnte: „Mon Dieu!“
„Sehen Sie mich an, Isabelle! Sehen Sie mich an, hören Sie ja nie auf damit!“
Tränen liefen über ihre Wangen, sie schüttelte den Kopf.
Da beugte er sich über sie, und seine Lippen berührten ihren Mund.
Sie erbebte erneut. Die Welt um sie herum zersprang und fügte sich neu zusammen. Sie klammerte sich an das Gitter in ihrem Rücken, und er verschlang sie, ließ nichts von ihr übrig, als ein wild pochendes Herz und die überwältigende Sehnsucht nach mehr. Sie ließ das Gitter fahren, legte ihre Hände um sein Gesicht, liebkoste es, während sein Mund sie gefangen hielt, mitten in diesem brandenden menschlichen Ozean.
Ein Ruck der Menge trennte ihre Lippen. Philippe stöhnte, biss die Kiefer aufeinander. Schweiß trat auf seine Stirn. Verzweifelte Schreie wurden laut um sie herum. Philippe knirschte mit den Zähnen. Sie legte ihre Hände auf seine Schultern, fühlte die stählerne Anspannung der Muskeln unter ihren Fingern. Ihre Wangen waren nass, doch noch immer lagen ihre Augen ineinander, noch immer schenkte er ihr diesen Blick, der die verrücktesten Gedanken in ihr entstehen ließ, wie den, dass es ein schöner Tod sein würde, hier, erdrückt in diesen Armen, sein Atem auf ihrem Gesicht, ihre Stirn an seiner Wange ...
Wie lange standen sie da, keuchend und schwitzend, die Todesangst im Nacken, das Glück auf den Gesichtern? Sekunden? Minuten oder Stunden?
„Peuple de Paris! Hört mich an, ihr braven Bürger!“, schallte es aus dem Innenhof.
Das Drängen an den Toren ließ endlich nach. Philippe atmete schwer, löste mit Mühe seine versteiften Finger von den Metallstäben. Isabelle drehte sich dem Hof zu. Sie lehnte sich an Philippes Schulter, spürte, wie schnell sein Herz schlug. Er legte die Arme um sie, zog sie an sich, und küsste ihr Haar.
Ein Mann war zwischen den Soldaten erschienen.
„De Souches! Es ist Hauptmann de Souches! Seid still, hört zu, was er zu sagen hat!“, rief eine autoritäre Stimme von hinten.
In der Tat erkannte Isabelle den Befehlshaber der Schweizer Garden von Gaston d’Orléans in dem Mann, der sich mit festen Schritten dem Tor näherte. Seine Züge waren noch strenger als sonst, und seine Augen waren von dunklen Schatten der Übermüdung umrandet.
Bei seinem Anblick kehrte Isabelle vollends in die Realität zurück. Monsieur, der seit Tagen jeglichen Kontakt zu der Königin abgebrochen hatte, hatte also mitten in der Nacht seinen Hauptmann zu der Regentin geschickt. Das Volk verlangte nach dem König, die Bürgermiliz schloss die Tore, als solle jemand an der Flucht gehindert werden ... Und Mazarin verharrte in Saint-Germain, wenige Meilen entfernt, trotz der immer massiveren Drohungen, die ihm aus Paris hinterhergeschickt wurden. Eine Ahnung stieg in Isabelle hoch. Sollten der Regentin und dem König die Flucht aus der Stadt gelungen sein? Sollten sie Paris sich selber überlassen haben, trommelten sie bereits eine Armee vor den Stadttoren zusammen, um ihre aufsässigen Untertanen zu belagern, sie auszuhungern? Oder planten sie eine vollständig Unterwerfung, die Einnahme der Stadt durch Waffengewalt, die Plünderung der Häuser, ein gewaltiges Blutbad? Isabelle erschauerte und zog Philippes Arme enger um sich.
„Ich habe den König gesehen!“, rief de Souches in dem Augenblick, ganz, als habe er ihre stillen Fragen gehört. „Ihre Majestät die Königin gewährte mir Eintritt in sein Schlafgemach.“
„Wie könnt Ihr Euch so sicher sein, dass es der König war?“, schrie eine Frauenstimme. „Vielleicht habt Ihr nur den Sohn der Kammerfrau gesehen!“
„Er war es!“ rief de Souches. „Ich kenne Seine Majestät. Kehrt heim, ihr braven Leute, in eure warmen Stuben! Macht es wie der König – geht schlafen!“
Ein Gemurmel ging durch die Reihen. Die Menschen sahen sich an, diskutierten angeregt mit ihren Nachbarn. Doch da erhob sich erneut eine Stimme, diesmal eine weibliche. „Ich glaub ihm nicht! Ich glaub überhaupt keinem mehr! Ich will selber den König sehen!“
„Ja, Recht hat sie!“
„Wahrscheinlich ist der König schon längst bei dem Italiener und sammelt Männer für die Armee, mit der er uns belagern will!“
Isabelle fuhr heftig zusammen, als plötzlich ein junger Mann neben ihr einen Sprung machte und sich an den Gittern des Portals hoch angelte. Sofort verfestigte Philippe seine beruhigende Umarmung.
„Wir trauen keinem!“, schrie der junge Mann. „Lasst uns den König sehen!“
„Ja, den König!“
„Le Roi! Le Roi!“
De Souches weitere Beschwichtigungsversuche wurden von den Schreien übertönt. Der Hauptmann blieb ein paar Sekunden lang stehen, betrachtete die Menge mit gerunzelter Stirn. Die Soldaten im Hintergrund fassten ihre Musketen. Isabelle schnappte nach Luft, als der Elan der Menschen sie erneut gegen das Tor warf. Ihr Blick huschte verzweifelt über die prächtigen, aber so stillen Fassaden des Palastes. Was ging hinter diesen Mauern vor? Stand dort Anne, irgendwo, und spähte mit ihren Hofdamen ängstlich auf ihr aufgebrachtes Volk hinunter? Wie sollte das alles enden?





