












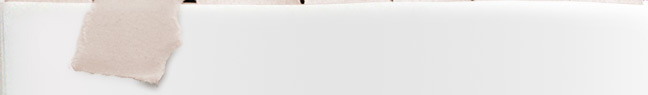





Die Ballonfahrerin des Königs
Marie-Provences Schritte hallten durch die prächtig getäfelten Räume des Schlosses. Sie hatte sich umgezogen, und die hohe Perücke drückte auf ihren Scheitel. Es war schon dunkel; das flackernde Licht der Öllampe in ihrer Hand spiegelte sich in der glatten Seide ihrer Schuhe.
Während sie an den Zimmern vorbeilief, nahm sie das Rascheln von Kleidern und gedämpfte Stimmen hinter den Türen wahr. Irgendjemand pfiff, eine Frau rief mit hochmütiger Stimme einen Befehl.
Vor einem der Räume blieb Marie-Provence stehen. Sie zögerte anzuklopfen und begnügte sich dann damit, leise an der Tür zu kratzen. Als keiner antwortete, drückte sie die Türklinke hinunter. Sie steckte den Kopf durch den Türspalt und trat ein, vorsichtig darauf bedacht, das Parkett nicht knarren zu lassen. Der Raum war zwar nur von mittlerer Größe, doch die Decke aufwändig mit Stuckelementen verziert. Nach ein paar Schritten erreichte der Lichtkreis ihrer Lampe eine Matratze auf dem Boden. Daneben befanden sich ein Becher, ein Krug, der Stummel einer Kerze auf einem Teller, eine zusammengeknüllte Decke und eine Bibel.
Die Gestalt auf der Matratze hatte ihr den Rücken zugedreht und rührte sich nicht. Marie-Provence beugte sich über sie, bis sie die unregelmäßigen Atemzüge des Mannes vernahm. Sie stellte ihre Lampe ab und griff nach der Decke, um sie über den Schlafenden zu legen.
Erst da entdeckte sie das Seil, das sich eng um die Knöchel des Ruhenden wand. Sie zog scharf die Luft ein. Hastig griff sie zu ihrer Lampe und hielt sie hoch – tatsächlich: auch die Hände waren gefesselt. Der Schlafende gab einen erstickten Laut von sich, warf sich von einer Seite auf die andere, ohne die Augen zu öffnen, und die Decke glitt erneut zu Boden.
„Geknebelt und gefesselt wie ein Schwerverbrecher“, flüsterte Marie-Provence ungläubig. Erneut griff sie zur Decke und breitete sie liebevoll über den Schlafenden aus. Dann entzündete sie noch den Docht des Kerzenstummels und stellte den Teller etwas abseits, ehe sie den Raum verließ.
Über eine kleine spiralförmige Treppe, die eigentlich den Dienstboten reserviert war, erreichte sie das Erdgeschoss. Hier waberten bereits die schwachen Düfte, die verrieten, dass ein Stockwerk tiefer das Abendessen vorbereitet wurde.
In Gedanken lief Marie-Provence den Weg zurück, den sie gerade gegangen war, hinab in das Kellergeschoss, in den Raum mit den gebrannten Fliesen, zu der kleinen Tür. Sie überprüfte jedes Detail in ihrer Erinnerung, jeden Riegel und jeden ihrer Schritte, bis sie wusste, dass ihr kein Fehler unterlaufen war. Nein, sie hatte alles getan, um sich und die anderen davor zu bewahren, entdeckt zu werden. Wenn das Schicksal es weiterhin gut mit ihnen meinte, würde das Schloss von Maisons, geplündert und vergessen von den revolutionären Horden, auch heute wieder die Menschen schützen, die dem nahen Paris und der Guillotine entflohen waren und in ihm verborgen lebten. Beruhigt verließ sie das Treppenhaus.
Kurz darauf betrat sie die Kapelle.
Der Raum war von einem einzigen Öllämpchen erhellt. Die feingliedrige Gestalt des abbé d’If wartete bereits auf der einen Seite des improvisierten Beichtstuhls auf sie. Selbst bei der dürftigen Beleuchtung wirkte die Soutane des Geistlichen abgeschabt. Marie-Provence bedeckte den Ausschnitt ihres schimmernden Seidenkleides mit einem Spitzentuch. Sie kniete auf der anderen Seite des groben Holzgitters auf einer Kiste nieder.
„Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und Seiner Barmherzigkeit“, empfing sie der Priester.
„Amen“, murmelte Marie-Provence.
„Schön, dass du gekommen bist, ma fille. Liegt dir etwas auf dem Herzen, Tochter?“
„Vater, ich habe gesündigt, denn mein Herz findet keine Ruhe.“
Der Pfarrer atmete hörbar ein und aus.
„Du warst wieder dort?“, fragte er.
„Ja, mon père. Ich habe am Tor gestanden, und kaum fuhr er an mir vorbei, fühlte ich mich erfüllt von Stärke und Entschlossenheit.“
Der abbé d’If schüttelte den Kopf. „Gib Acht, ma fille. Du bist auf dem besten Wege, dich selber zu täuschen. Rache gebärt weder Stärke noch Entschlossenheit, sondern Missgunst und Gewalt.“
„Und das Kind?“, fragte Marie-Provence. „Zeugt es etwa von christlicher Menschenliebe, es einfach zu vergessen?“
Ein Geräusch draußen im Park ließ sie kurz innehalten und lauschen. Auch der abbé d’If drehte den Kopf in dieselbe Richtung. Sie schwiegen angespannt. Nach ein paar Sekunden nahm der Priester das Gespräch wieder auf.
„Der Junge ist nicht vergessen. Ich bete täglich für ihn.“
„Mir genügt beten nicht“, entgegnete Marie-Provence.
„Ich möchte, dass du in dich gehst. Bist du dir im tiefsten Grunde deines Selbst ganz sicher, dass es nicht Stolz und Vermessenheit sind, die dich lenken? Würdest du dem Jungen auch helfen wollen, wenn seine Eltern Bauern gewesen wären?“
Marie-Provence schloss die Augen und legte die gefalteten Hände an die Stirn.
Blondes Haar, das immer etwas unordentlich war. Blaue Augen, und eine klebrige kleine Hand, die sich vertrauensvoll in die ihre schob. Eine klare hohe Jungenstimme. Marie, ich habe Maman gesagt, dass ich Dich später zum Kommandanten meiner Leibgarde machen werde!
Ihr Lachen, das ihr sofort eine Zurechtweisung eingebracht hatte.
Lach nicht! Knie Dich hin!
Aber warum denn?
Ich muss Dir mein Schwert umbinden.
Sie hatte sich um ein ernstes Gesicht bemüht und war auf dem feuchten Kies der Parkallee in die Knie gegangen. Sofort hatte der Vierjährige sich an ihrem Seidenkleid zu schaffen gemacht.
So! Ein zufriedenes Kindergesicht. Jetzt bist Du verpflichtet, mich zu beschützen, Dein Leben lang. Und Du darfst mich nie, nie mehr allein lassen! Zwei kleine Arme, die sich um ihren Hals legten und sie drückten, bis sie lachend um Gnade flehte.
„Ich sah ihn aufwachsen, mon père“, sagte Marie-Provence sanft. „Er ist der kleine Bruder, den ich nie hatte. Und das letzte Bisschen Familie, das mir bleibt.“
„Du hast noch deine Tante und deinen Onkel.“
„Das ist richtig. Doch sie sind versorgt. Keiner von ihnen braucht mich so wie er.“
„Bist du dir da so sicher, ma fille? Ist dir eigentlich bewusst, wie krank dein Onkel ist?“
Marie-Provence senkte den Kopf. „Ihm zu helfen steht nicht in meiner Macht.“
„Dem Jungen aber schon?“
Marie-Provence legte eine Hand auf die Tasche ihres Kleides. Der Ausschnitt aus dem Journal de Paris knisterte leise als Antwort. Erregung und Hoffnung veränderten ihre Stimme: „Dem Jungen vielleicht schon. So Gott mir hilft."
.................................................................. 
„Mon Dieu!“, schrie (Marie-Provence) auf und machte unwillkürlich einen Schritt zurück. Verblüffung, Faszination, Furcht und Begeisterung zugleich zeichneten sich auf ihren Zügen ab.
(André) lächelte und legte den Kopf in den Nacken. Wie immer bewirkte Zéphyrs Anblick, dass sein Herzschlag sich beschleunigte. Stolz und zufrieden betrachtete André die gespannten Flanken des Ballons, die perfekte Wölbung des blauseidenen Leibes, auf dem ein Gott dargestellt war, der aus prallen Backen goldene Wolkengebirge wegblies. Die gigantische Konstruktion zerrte an ihren Seilen, und wie stets übertrug sich dieser offenbare Drang zu entkommen auf André. Der prickelnde Vorgeschmack der vollendeten Freiheit breitete sich auf seiner Zunge aus.
„Alors, wie findest du meinen Zéphyr?“, fragte er. Als er in die blitzenden Augen seiner Begleiterin sah, strahlten diese heller denn je.
„Dein Zéphyr? Willst du etwa sagen, dass du ihn gebaut hast?“
„Entworfen und gebaut, ja.“
„Er ist wundervoll!“, lachte die junge Frau. „Womit ist er gefüllt? Es ist doch kein Heißluftballon?“
„Nein“, antwortete er überrascht. „Er fliegt mit Wasserstoff. Woher weißt du das?“
Marie-Provence stand da mit weit aufgerissenen Augen, konnte sich offenbar nicht satt sehen an dem Schauspiel. Ihre Begeisterung entzückte ihn. Und wie gut er sie verstand!
Gerade einmal zwölf Jahre war es her, dass Joseph de Montgolfier beobachtete, wie heiße Luft sein zum Trocknen aufgehängtes Hemd aufblies. Und noch nicht einmal elf, seit sich zum ersten Mal ein Mensch in einem Ballon in den Himmel erhoben hatte. Noch immer sanken Bauern auf die Knie und bekreuzigten sich, wenn sie ein solches Gefährt erblickten, noch immer war man sich nicht sicher, ob die Menschen nicht mit Sicheln und Mistgabeln angelaufen kämen, wenn man neben einem Dorf landete, um den Ballon, das vom Himmel gefallene Tier der Apokalypse, zu erlegen. Fliegen war der größte Traum der Menschheit, seit vor vielen Hunderten von Jahren in China Drachen aufgestiegen waren, die ersten vom Menschen geschaffenen Fluggeräte überhaupt. Man hatte gerade erst begonnen, diesen Traum zur Wirklichkeit werden zu lassen. Es gab nichts, was André mehr beglückte, als zu wissen, dass er seinen Beitrag zu diesem Traum leistete – und es war wunderbar zu sehen, dass die Frau neben ihm seine Begeisterung teilte.
„Mein Vater hat einmal den Aufstieg eines Heißluftballons miterlebt,“ berichtete Marie-Provence angeregt. „Vor zehn Jahren, als mit den allerersten Flügen begonnen wurde. Was habe ich damals gebettelt, um mitzudürfen! Aber ich musste mich mit Vaters Bericht zufrieden geben. Pilâtre de Rozier und Proust waren die Fahrer. Der Ballon war unter einem Zelt versteckt und schoss plötzlich in den Himmel. Mein Vater hat mir eine Gravur mitgebracht, auf der das Luftschiff abgebildet war. Es sah ganz anders aus als dieses: es hatte unten eine Öffnung und eine große Plattform. Mein Vater erzählte, dass die Fahrer ständig etwas verbrennen mussten, das sie mit Forken unter die Öffnung warfen.“
André konnte seine Überraschung kaum verbergen. Ein Zelt? Rozier und Proust? Vor zehn Jahren war ein einziger Flug gestartet, der dieser Beschreibung entsprach. Allerdings hatte er vor ausgewähltem adligem Publikum stattgefunden. Verwundert betrachtete er seine Begleiterin, doch ihr strahlendes Gesicht ließ ihn seine Fragen vergessen. „Sie sagten, Sie wären gerne mit dabei gewesen. Wären Sie denn auch gerne einmal mitgefahren?“
„Mit so einem Ballon?“ Ihre Augen glitten über den Giganten, der sich in seinen Seilen wiegte wie ein mächtiges Tier. „Oh, es wäre das Wundervollste und Aufregendste, das ich mir vorstellen kann!“ Nach einer kurzen Pause fragte sie vorsichtig: „Glauben Sie, der Fahrer dieses Ballons würde mich mitnehmen?“ Ihre Erregung war fast greifbar.
„Ich würde Sie überallhin mitnehmen!“, gestand er. Noch nie, so spürte er, war er dem Glück so nahe gewesen.
Eine spöttische Stimme fuhr dazwischen. „Na, dass ich das noch erleben darf! Mein Bruder höchstpersönlich!“
„Mein Bruder Mars“, stellte André vor. Mars hatte sich herausgeputzt: Sein Haupt trug das rote Kennzeichen der Republikaner, die phrygische Mütze, auf seiner Brust prangte die Kokarde und um seinen rundlichen Oberkörper lief eine blauweißrote Schärpe. Zu seinem Bruder sagte André: „Wir können jetzt los. Wie steht der Wind?“
Mars deutete auf einen bunten Taftstreifen, der an einer Stange flatterte. „Er hat ein wenig gedreht. Nord, Nord-Ost, würde ich sagen.“
André nickte zufrieden. „Habt ihr die Flugblätter an Bord gebrachte?“
„Natürlich.“ Mars hob die Brauen und betrachtete Marie-Provence argwöhnisch. „Und wer ist das? Sollte das etwa der Grund unserer Verspätung sein?“
Sofort nahm Marie-Provences Gesicht wieder den wachsamen, zurückhaltenden Ausdruck an, von dem sie nur selten ließ, und André antwortete seinem Bruder kurz angebunden: „Das ist meine Begleiterin auf diesem Flug, Bruder.“
„Eine Begleitung? Es war nie die Rede …“
„Ich brauche jemanden, der die Flugblätter wirft, während ich auf den Ballon aufpasse.“
„Warum hast du davon früher nichts gesagt?“
„Warum sollte ich? Die Organisation des Fluges und der Ablauf stehen allein unter meiner Verantwortung.“ André wusste, dass er seinen Bruder reizte. Doch ein Instinkt riet ihm, dessen Groll besser auf sich zu ziehen und von seiner Begleiterin abzulenken. Er, der den Anfeindungen seines Bruders sonst lieber aus dem Weg ging, war auf einmal entschlossen, Front zu machen.
Die dunklen Augen seines Bruders verengten sich. „Kann ich deine Papiere sehen, citoyenne?“, fragte er knapp.
„Was soll das?“, fuhr André ihn an.
„Du magst für den Flug verantwortlich sein, aber ich muss vor meinen Auftraggebern dafür gerade stehen, dass nur treue Anhänger der Republik während dieser Veranstaltung öffentlich auftreten!“
André wollte gerade mit einer heftigen Antwort parieren, da antwortete seine Begleiterin kühl: „Das verstehe ich, citoyen“, und überreichte Mars ihre Dokumente.
Mars studierte den Ausweis mit kränkender Genauigkeit, ehe er ihn zurückgab. „Also gut, meinetwegen“, sagte er. Barsch fügte er hinzu: „Allerdings musst du noch etwas mit dir machen, citoyenne! Ganz Paris wird heute zu euch aufschauen. Dein Kleid erinnert mich viel zu sehr an eine Nonnentracht. Du wirst die Haube abnehmen und die Haare offen tragen. Vielleicht steckst du noch ein paar Blumen hinein, dann mag es durchgehen. Nein, warte!“ Er griff an seine Taille, löste das blauweißrote Stoffband, das er sich umgebunden hatte, und streckte es ihr hin: „Leg das um. Und zieh meine Mütze an. Das dürfte reichen, um aus dir eine ordentliche Patriotin zu machen.“
Marie-Provence zögerte, nahm ihm dann aber Schärpe und Mütze ab. „Ganz wie du es wünschst, citoyen“, antwortete sie.
Endlich ließ Mars von ihnen ab und stapfte davon.
„Es tut mir leid“, stieß André aus.
Sie blieb reserviert und lächelte unverbindlich.
Er hätte alles gegeben, damit ihre Augen ihn erneut anstrahlten. Voller Groll sagte er: „Mein Bruder schimpft sich Republikaner und ist dennoch der schlimmste Tyrann auf Erden.“
„Was hat er gegen dich?“
„Seiner Auffassung nach schätze ich das, wonach er sich verzehrt, nicht genug.“
„Wonach verzehrt er sich denn?“
„Nach der Fabrik unseres Vaters“, erklärte er, während er verfolgte, wie sie die Nadeln aus ihrer Frisur zog. Die Haare fielen ihr den Rücken hinunter. Sie waren glatt und schwer, und so dunkel wie Ebenholz. André musste zugeben, dass Mars recht hatte. Mit den offenen Haaren, auf denen sie nun die rote phrygische Mütze platzierte, ihrer schneeweißen Robe und der Schärpe, die ihren Oberkörper umspannte, gab Marie-Provence das Fleisch gewordene Bild der republikanischen Tugend ab. Er starrte sie an, überwältigt, wie das allererste Mal, als er sie auf dem Marktplatz erblickt hatte.
„Und du? Was schätzt du?“, fragte sie leise.
Er lächelte, obwohl sich etwas in ihm schmerzhaft zusammenzog,. „Ich schätze … Ich schätze, wir sollten jetzt losfliegen!“, sagte er schnell, bevor ihm etwas herausrutschte, das sie vielleicht verschreckt hätte.
Sie lächelte ihn an. „Auf was warten wir dann noch?“
Die Männer, die um den Korb versammelt waren, immer wieder die Halteseile überprüften, Fässer wegrollten und Schläuche zusammenlegten, die der Füllung der seidenen Hülle gedient hatten, wechselten ein paar Worte mit André Levallois. Während dieser den Ballon umrundete, die Festigkeit verschiedener Knoten testete und alles einer letzten, gründlichen Inspektion unterzog, betrachtete Marie-Provence das beeindruckende Gefährt aus der Nähe.
An dem Netz, das auf dem Scheitel des Ballons ruhte und ihn umspannte, waren auf halber Höhe Seile befestigt. Diese dienten der Verankerung; ihre Enden waren um Holzpflöcke im Boden geschlungen. Am Saum des Netzes hing der längliche, elegant geschwungene Korb, der einer venezianischen Barke ähnelte. Sein Inneres war mit Leinen ausgekleidet, blauweißrote Kokarden und buschige Eichenzweige schmückten ihn, und mehrere Säcke hingen an seinem Rand. Eine leichte Brise trieb gegen den Ballon und entlockte dem gefesselten Riesen ein kontinuierliches Seufzen und Ächzen.
„Also gut, Männer, alle zu den Seilen! Es geht gleich los!“, rief André, bevor er Marie-Provence eine Hand bot. Seine Augen leuchteten. „Komm!“
Als es daran ging, in den Korb zu steigen, hatte Marie-Provence plötzlich weiche Knie. Der Ballon, der nun über ihrem Kopf schwang, erschien ihr unfassbar groß und mächtig, und wären nicht Levallois und seine feste Hand gewesen, hätte sie vielleicht auf der Stelle kehrt gemacht.
„Du brauchst nichts zu befürchten. Du hast doch keine Höhenangst?“
Marie-Provence schluckte. „Ich weiß nicht … Nein, ich glaube nicht“, stotterte sie, während sie den Korbrand überwand und sich einen Platz zwischen den verschnürten Papierstapeln, dem Anker und zwei Kisten suchte.
„Gut. Halte dich fest, alles andere kannst du mir überlassen.“ Er drehte sich von ihr weg. „Löst die Halteseile!“
Ein Ruck ging durch den Korb. Marie-Provence schrie auf, im Glauben, es ginge nun los, doch dann wurde ihr klar, dass die Seile zwar von den Bodenankern gelöst worden waren, aber noch von den Männern gehalten wurden.
André sah sie erwartungsvoll an. Erregung ließ seine Augen funkeln. „Bist du bereit?“, fragte er. Als sie nickte, beugte er sich vor. „Lâchez tout!“, brüllte er. „Loslassen!“
Marie-Provence schnappte nach Luft. Der Ballon geriet erneut in Bewegung. Schon dachte sie, es sei soweit, als sich der Korb zur Seite neigte.
André beugte sich über den Korbrand und rief scharf: „Ich hab gesagt, alle Seile loslassen! Hört auf zu träumen, da unten!“
Das letzte Halteseil entspannte sich, und sofort richtete sich der Ballon nach dem Wind. Marie-Provence umklammerte den Korbrand, während sich der Garten mitsamt den Menschen immer weiter entfernte. Die Arbeiter johlten, winkten und riefen. Doch Marie-Provence brachte es nicht fertig, den Korbrand loszulassen, um zurückzuwinken, atemlos wie sie war, überwältigt von fremdartigen Empfindungen, und mit einem seltsamen Gefühl im Magen.
Die mächtige Polierhalle zog an ihnen vorbei, die verrußten Fassaden des Klosters, die Baumwipfel der höchsten Eichen. In gemächlichem Tempo stiegen Marie-Provence und André, bis die Brise sie erfasste und sanft seitwärts drückte.
Ihr Herzschlag beruhigte sich ein wenig. Sie sah sich um. André Levallois hatte ein Instrument in der Hand, das er aufmerksam studierte.
„Ein Barometer. Es dient zur Höhenmessung“, erklärte er.
Sie nickte ernsthaft, als sei es das normalste der Welt, sich mit derlei Dingen zu befassen, und unterdrückte einen Ausruf, als sie über die ersten Häuserreihen hinwegzogen. Gebannt sah sie auf die Schieferdächer und den Wald aus Schornsteinen hinab. Zu ihrer Rechten erhaschte sie einen Blick auf die place des Piques, wie man die place Vendôme heute nannte, und auf den leeren Sockel in ihrer Mitte, den schon lange kein steinerner König mehr zierte. Als sie leicht wie eine Feder über die prächtige Häuserzeile glitten, die den Platz rahmte, legte Marie-Provence die Hände an die Wangen und lachte.
André, der gerade eine Banderole am Korb befestigte, drehte sich um. „Es gefällt dir?“
„Es ist das Wunderbarste, das ich jemals erlebt habe!“ Sie lachte erneut, breitete die Arme aus und stellte sich in die Flugrichtung. „Ich habe immer davon geträumt!“ Ihre Stimme überschlug sich. „Ich fliege! Mein Gott, ich fliege!“
Die Banderole entrollte sich, und die Worte „Vive la république!“ erschienen, überdimensional groß.
Der Ballon flog über die rue Saint Honoré, geometrisch gezeichnete Gärten, kugelige Baumwipfel. Scharen von Menschen sahen zu ihnen hoch. Sie schrien, zeigten in Richtung Himmel. Etliche begannen mitzulaufen. Kinder kreischten und klatschten. Noch ein paar Dächer – und plötzlich lagen vor Marie-Provence und André die Tuileries mit ihren weitläufigen Alleen und Rasenflächen. Von diesen war allerdings nicht viel zu sehen, denn es wimmelte von herausgeputzten Menschen.
„Wie friedlich diese Menschen alle aussehen“, entfuhr es Marie-Provence. „Kann man glauben, dass etliche von ihnen massakrierend durch die Gefängnisse gezogen sind? Dass sie Gräueltaten begangen haben, zu denen Tiere nicht fähig wären? Wie ist das möglich?“ Sie staunte über das Spektakel: die Fête de l’Être Suprême lag zu ihren Füßen – ganz, wie André Levallois es ihr versprochen hatte.
.................................................................. 
Er hatte ihr nicht nacheilen wollen, als er aus der maison de la couche rannte. Doch dann leuchtete ihm schon von weitem ihr blaues Kleid vom Platz der Kathedrale entgegen. Und dann sah er den Mann, auf den sie zuging. Sehnig und schlank. Seine Stiefel waren abgestoßen, die Krempe seines Hutes gebrochen. Und doch bewegte er sich mit einer Selbstsicherheit, als gehöre die Stadt ihm.
André sprang hinter einen Baum, schmiegte sich an die feuchte raue Rinde. Mit brennenden Augen beobachtete er, wie der Mann die Arme öffnete. Marie-Provence warf sich hinein, schüttelte den Kopf, barg ihr Gesicht an seiner Brust. Er umschloss sie, redete auf sie ein. Drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel.
André wandte sich ab. Verharrte einige Augenblicke, zwang sich, zu warten, bis seine Atmung sich beruhigt hatte. Dann sah er erneut hinüber und erspähte das Paar gerade noch, als es einen Leihwagen bestieg und davonfuhr. Zeit zum Nachdenken blieb da keine. Er rannte los, warf sich in eines der wartenden Gespanne.
Kurz hallte ihre Stimme in ihm nach: Versprich es mir, André. Du darfst mir keine Fragen stellen, über mich nachforschen oder mich verfolgen! Doch mit einem Faustschlag gegen das Verdeck brachte er die Stimme zum Schweigen.
„Folgen Sie dieser Kutsche!“ schrie André.
Als er aus dem Wagen stieg, brummte André der Schädel. Die Fahrt hatte sich hingezogen, es war inzwischen nach Mittag. Er blinzelte in den Regen.
„Wo sind wir überhaupt?“
Der Kutscher sah ihn an, als mache er sich Sorgen über den geistigen Zustand seines Fahrgastes. „In Sartrouville, citoyen. Drüben steht der Wagen des Kollegen. Die Leute sind zur Kirche da hinten gelaufen.“
Sartrouville? André entlohnte den Kutscher und sah sich um. Hier war er noch nie gewesen. Er war Pariser durch und durch, und was er von Sartrouville sah, überzeugte ihn, dass er bisher nichts versäumt hatte. Inzwischen war seine Wut verraucht. Geblieben war ein unendlich scheußliches Gefühl; ganz gleich, was er hier auch entdecken mochte, nichts würde es verschlimmern können.
Wie André bald feststellte, war die Kirche keine mehr, sondern ein Restaurant, das den kriecherischen Namen Robespierre, Licht der Nation trug. Er blieb im Schutz eines wuchtigen moosbepolsterten Kreuzes stehen, die Hände in den Hosentaschen, unschlüssig, was er jetzt machen sollte. Wahrscheinlich tafelten Marie-Provence und ihr Begleiter gerade vergnügt, während er hier mit knurrendem Magen im Regen stand. Erneut stieg Zorn in ihm auf, auch Zorn auf sich selber, weil er sich wegen Marie-Provence zum Idioten machte.
Da quietschte es leise unter seinen Sohlen. Er sah zu Boden − Kohlköpfe und Erbsen. Er war dabei ein Gemüsebeet zu zertrampeln, das jemand zwischen den Gräbern angelegt hatte. Er erwog gerade, eine Möhre als Mittagessen aus der Erde zu ziehen, als sich plötzlich eine Seitentür der Kirche auftat. Marie-Provence, der Mann, und eine fremde Frau mit hellbraunen, lockigen Haaren traten heraus. Zu Andrés Überraschung schlugen sie einen Weg zur Rückseite des Gebäudes ein, nachdem sie sich aufmerksam umgesehen hatten. Ohne zu zögern, folgte er ihnen vorsichtig.
Je weiter sie vordrangen, desto unübersichtlicher wurde der Bewuchs. Hier hatte lange kein Gärtner mehr eingegriffen. Dornensträucher, immergrüne Büsche und Unkraut waren zu einem kaum durchdringbaren Dickicht verwachsen. Nichtsdestotrotz schienen die drei Menschen vor André genau zu wissen, wohin sie gingen. Sie sagten keinen Ton, bogen aber in stummer Übereinkunft tropfnasse Zweige beiseite, um zwischen ihnen hindurch zu schlüpfen. André tat es ihnen mit einigem Abstand nach. Bald schon waren seine Schuhe, seine Hose und die Ärmel seiner Jacke durchnässt. Sein Zorn war inzwischen reger Neugier gewichen. Was um alles in der Welt wollten die drei hier? Er erhaschte einen kurzen Blick auf Marie-Provences Gesicht − ihre Augen waren gerötet, als hätte sie geweint.
Plötzlich tauchte eine kleine Kapelle in dem Urwald auf. Die zweite Frau war stehen geblieben, bückte sich und schob ein paar blühende Ranken weg. Der Mann mit der gebrochenen Krempe griff nach unten und zog – Andrés Augen weiteten sich, als sich vor den drei Menschen plötzlich eine Falltür auftat. Die beiden Frauen fassten sich kurz an den Händen, lächelten sich an. Dann stieg Marie-Provence in das Loch und entschwand seinen Blicken. Der Mann richtete sich noch einmal auf. Der Blick, mit dem er sich umsah und jeden Busch, jeden Halm einer genauen Untersuchung unterwarf, war so scharf, dass André sich beherrschen musste, sich nicht zu ducken; jede noch so kleine Bewegung hätte ihn vermutlich verraten. Dann stieg auch der Mann hinab. Zurückblieb die Frau mit den lockigen Haaren, die die Falltür wieder sorgfältig mit den Ranken bedeckte und schließlich zur Kirche zurückging.
André blieb ein paar Minuten im nassen Unkraut hocken. Sein Drang, mehr über Marie-Provence zu erfahren, seine neu aufkeimende Eifersucht und sein altes, vernünftiges Ich stritten erbittert miteinander. Bis der Regen erneut zunahm und ein Rhododendronblatt ihm einen Schwall kalten Wassers in den Nacken goss. Er war auf dem besten Wege, sich hier im Dauerregen zu erkälten. Es entsprach, versicherte er sich, nur dem gesunden Menschenverstand, einen Unterschlupf aufzusuchen. Vorsichtig verließ er sein Versteck. Er sah um sich, doch alles war ruhig.
Als er vor der Falltür niederkniete und die betörenden Ausdünstungen der blühenden Geißblattranken einatmete, hielt er inne. Nun wusste er, woher der Duft stammte, der immer von Marie-Provence ausging. Sie musste täglich hier vorbeikommen.
Er fegte die Ranken beiseite und packte den rostigen Eisenring.
Wie lange lief er wohl schon? Zehn Minuten? Eine Viertelstunde? André hätte es unmöglich sagen können. Das Einzige, was er ahnte, war, dass er ziemlich genau in Richtung Westen ging. Er hatte ein Gespür für Himmelsrichtungen, das ihm beim Ballonfahren öfters den Blick auf den Kompass ersparte.
Für Westen sprach außerdem, dass der Gang zunehmend feuchter wurde. An mehreren Stellen hatte er Pfützen ausweichen müssen. Der Geruch, den das Wasser verströmte, war für einen Pariser unverkennbar: Es war eindeutig die Seine, die die Ohrwürmer, Spinnen und Asseln, die an Wänden und Decke über seinem Kopf wuselten, aus ihren Schlupfwinkeln zwischen den Steinen getrieben hatte. Er versuchte, die Kriechtiere zu ignorieren, doch das fiel ihm schwer.
Ein plötzliches Hindernis ließ ihn stolpern. Als er die Fackel hob, merkte er, dass er sich am Fuß einer Treppe befand, die steil nach oben führte. Endlich! Zufrieden, dem Schlamm zu entkommen, machte er sich leichten Fußes an den Aufstieg.
Die Treppe mündete auf einen langen, ebenerdigen Vorraum, von dem vier bis fünf Türen abgingen. Keller, allesamt. Im ersten von ihnen hing eine nackte Seilwinde an der Decke, unter der sich eine mächtige Falltür befand. André schwenkte seine Fackel und beschloss, nicht weiter zu untersuchen, was sie verdeckte. Früher mochten diese Keller vielleicht mit Weinfässern und Vorräten gefüllt gewesen sein, heute fand sich hier jedoch nichts als Mäuseköttel. Er kehrte zu der Treppe zurück und folgte ihr weiter nach oben. Als sie schließlich auf einem Absatz an einer Tür endete, öffnete er diese vorsichtig.
Er betrat eine Küche. Staunend löschte er die Fackel und sah sich um. Größe und Ausstattung ließen auf ein stattliches Haus schließen, genau wie die große Anzahl der Keller vorhin. Wo um alles in der Welt war er gelandet? Und wo war Marie-Provence?
Seine schlammigen Schuhe knirschten auf den abgetretenen Terrakottafliesen, als er durch den Raum schlich. Ein paar Vorräte. Kurz entschlossen griff er zu einer Scheibe Brot und biss beherzt hinein, während er sich weiter umschaute. Der Kamin war gekehrt, keine Glut lag darin. Kalte Suppe hing in der Esse. Ein derber Tisch, sonst aber kaum Einrichtungsgegenstände. Auf der gegenüberliegenden Seite der Küche ging ein sehr breiter und heller Flur ab. Durch eine offene Tür an dessen Ende entdeckte er einen weiteren Kamin. In dem hätte man allerdings eine ganze Rinderherde auf einmal brutzeln können! Er stutzte. Noch eine Küche? Gab es hier denn keine Zimmer?
Hohe Flügeltüren zu seiner Linken sowie mehrere Fenster ließen Licht in den Flur. Er spähte kauend nach draußen – und runzelte die Stirn. Ein großes, nacktes Areal bedeckt mit Kies, eine hohe lange Wand aus hellen Steinquadern … Er sah nach oben, erblickte eine Brüstung, und erkannte, dass er sich auf der Höhe eines künstlichen Grabens befinden musste. Der Gang hatte ihn in ein Schloss geführt. Fieberhaft überlegte er: ein Schloss westlich von Sartrouville? Das einzige, das ihm einfiel … Er sah sich ungläubig um.
Er musste nach oben!
Im Erdgeschoss angelangt, drehte er sich in der quadratischen Eingangshalle auf den schwarzweißen Bodenfliesen, sprachlos, überwältigt. Schneeweißer Stuck, wohin man auch schaute. Kunstvoll gemalte Szenen, die die vier Elemente darstellten. Adler, die ihn aus den vier Ecken beäugten und ihn in seiner Vermutung bestätigten: Die Raubvögel betrachteten André mit ihrem „long œil“, ihrem scharfen Blick, und erinnerten damit an René de Longueil, der vor anderthalb Jahrhunderten das Schloss von Maisons bei dem Architekten Mansart in Auftrag gegeben hatte. Jetzt wusste André, wo er war.
Sein Blick glitt über sich verjüngende dorische Säulen. Fein geriffelt und mit delikaten Blütenranken verziert, waren sie ein Wunder an Anmut und Raffinesse. Sie schossen seitlich von zwei ziselierten Gittern hoch. Diese zierten die sich gegenüber liegenden Flügeltüren, die sich zu seiner Rechten auf den riesigen, bis zur Seine abfallenden Park öffneten, zu seiner Linken auf eine Abfolge von Terrassen und Höfen.
André hatte in den vergangenen Jahren viele herrschaftliche Häuser von innen gesehen. Architektur war nicht seine Leidenschaft, dennoch hatte die Tätigkeit im Geschäft seines Vaters ihm einen Sinn für Proportionen, Eleganz und Leichtigkeit verliehen. Und dieses war eindeutig das Schönste, was er jemals gesehen hatte. Es war so vollkommen, dass er sich von dem Anblick regelrecht losreißen musste.
Nun stand er vor der Wahl − rechts oder links?
Rechts befand sich der Zugang zum ersten Stockwerk. Eine schneeweiße, schwebende Treppe schraubte sich nach oben zu einer Gruppe balgender Putti hinauf. André stopfte sich das letzte Stück Brot in den Mund und entschied sich für links. Drei Räume und ein schmaler Gang, allesamt kahl. Die einzigen Einrichtungsgegenstände waren ein paar Bücher und alte Zeitungen, die in einer Ecke lehnenden Queues eines Billardspieles, ein angeschlagener Geigenkasten, einige Kissen, Decken und Sitzgelegenheiten, die eher provisorisch als bequem anmuteten. Je weiter André vordrang, desto weniger konnte er sich einen Reim auf das Ganze machen.
Er betrat den letzten Raum des linken Flügels. Eine Kapelle, war sein erster Gedanke, als er durch die Tür trat und den kleinen Altar sah.
Dann sah er zu Boden und erblickte den Leichnam.





